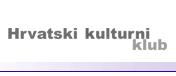Begegnung mit der Kathedrale in �ibenik

Gesamtansicht der Šibeniker Jakobskathedrale
Meine erste Begegnung mit der Šibeniker Jakobskathedrale (Sv. Jakov) war zufällig. Mein Freund und ich arbeiteten als freiwillige Helfer in einem kroatischen Flüchtlingslager in der Nähe von Šibenik. Dort, am Ufer der Adria, entdeckte ich ein Bauwerk, das mich sofort faszinierte: Eine Kirche, noch vom Krieg durch aufgestapelte Sandsäcke vor Granaten geschützt, mit eigentümlich geformter Fassade. Ihre drei halb- bzw. viertelkreisförmigen Giebel erinnern an die Blätter eines Kleeblattes. Daher nenne ich sie Kleeblattfassade (kroatisch: trolisna pro�elja). Im Deutschen gibt es dafür nur die Bezeichnung „welscher (also: italienischer) Giebel“. Denn Italien, die „Wiege“ der Renaissance, gilt als Ursprungsland dieses Giebels. Aber genau das begann ich zu hinterfragen. Angespornt von der Skepsis und Neugier meiner Professoren widmete ich mich der Jakobskathedrale und ihrer Fassade in meiner Magisterarbeit (Leipzig, 1998). Ich wollte herausfinden, wo die Kleeblattfassade entstanden war, in Šibenik oder in Venedig. Zunächst galt es, bei der Literaturrecherche sprachliche Barrieren zu überwinden. Zumal von deutschen Kunsthistorikern die Architektur Dalmatiens seit dem Ende der K & K - Monarchie eher vernachlässigt wurde. Insofern moniert Radovan Ivan�evi�, Professor an der Philosophischen Fakultät der Uni Zagreb, zu Recht, dass „viele von diesen Werken der europäischen und der Weltöffentlichkeit nicht bekannt sind.“

Die Jakobskathedrale in Šibenik aus der Vogelperspektive
Eine gute Mischung
Wer die Jakobskathedrale zum ersten Mal sieht, ist beeindruckt von ihrer ausgewogenen Architektur, die wie aus einem Guss entstanden scheint. Beim näheren Hinsehen entdeckt man jedoch zwei verschiedene Stile. Formen der Gotik und der Renaissance sind hier harmonisch miteinander vereint. Das Zusammenspiel der Stile lässt sich gut an der Fassade erkennen: Die Spitzbogenfenster, das Portal und die Fensterrosetten zeugen von dem gotischen Bauabschnitt. Die Pilaster, Friese und Gesimse hingegen gehören schon zur Formensprache der neuen Epoche. Vor allem aber der Kleeblattgiebel, der aus einfachen Kreissegmenten gebildet ist. Geometrische Formen wie Kreise oder Quadrate entsprachen der Ästhetik der Renaissance. Der für Dalmatien typische Mischstil verrät, dass die Kirche zu einer Zeitenwende gebaut wurde. Über ein Jahrhundert dauerten die Bauarbeiten: von 1431 bis 1535. Heute, in der Rückschau von einem halben Jahrtausend, ist demnach die Frage nach dem Urheber der Kleeblattfassade nicht so schnell zu beantworten. Zumal neben einheimischen Baumeistern an der Jakobskathedrale auch Venezianer, Florentiner und Albaner am Werk waren. Es muss ein regelrechtes Sprachgewirr auf der Baustelle gegeben haben.
Eine internationale Baustelle
Der erste und unterste Bauabschnitt (1431-41) ist geprägt vom Geist und Stil der Gotik. In diesem Jahrzehnt waren venezianische Baumeister tätig. Sie kamen für den Giebelentwurf nicht in Frage, da ihre Baupläne später grundlegend geändert wurden.
Die nächste, über 30-jährige Bauphase (1441-1473) leitete Juraj Dalmatinac - also ein „Dalmatiner“. Der begabte Bildhauer und Architekt aus Zadar hatte den Kopf voller Ideen. Er entwarf eine Kathedrale in viel grösseren Dimensionen als ursprünglich geplant. Unter ihm entstanden Querschiff, Apsiden und eine Taufkapelle. Neben anderen Steinmetzarbeiten schuf Juraj Dalmatinac einen Fries aus 72 gemeisselten Köpfen. Aus Stein gehauene Gesichter mit individuellen Zügen von Zeitgenossen. Angeblich stellen die hässlicheren Charaktere jene geizigen Šibeniker Bürger dar, die sich vor Spenden für den Kirchenbau gedrückt hatten. Auf das Geld war man angewiesen, denn finanzielle Engpässe gab es damals schon. Darum auch die lange Bauzeit.
Nach dem Tod von Dalmatinac trat Niccolò Fiorentino aus Florenz 1475 die Nachfolge am Dombau an. Er erbaute eine achteckige Kuppel und vollendete die Kleeblattfassade, deren Entwürfe höchstwahrscheinlich auf seinen Vorgänger zurückgehen. Formgebend für die Fassade war nämlich eine bis dahin unbekannte Dachkonstruktion, die Juraj Dalmatinac erfunden hatte. Es war ein tonnengewölbtes Dach, das komplett aus Stein bestand: Marmor von der Insel Bra�. Ein kostbarer Baustoff für ein Dach. Der weiße Bra�er Marmor diente übrigens nicht nur in Šibenik als Baumaterial, sondern auch dem Diokletianpalast in Split, dem Weissen Haus in Washington und dem Berliner Reichstag. Die Jakobskathedrale dürfte die einzige europäische Kirche sein, die samt Dach und Kuppel ausschliesslich und vollständig aus Stein besteht. Wie war das möglich?

|

|
| Tonnendach aus Marmorplatten |
Mittelschiff mit Tonnendach |
Marmor statt Holz
Juraj Dalmatinac hatte eine geniale Idee: Statt das Dach aus Holz zu zimmern, sollte es nun aus massiven bretterlangen Marmorplatten montiert werden. Diese liegen wie Dachziegel übereinander, gehalten von mächtigen Steinbögen hoch über den Kirchenschiffen. Wie Legosteine greifen die Steinplatten ohne Mörtel ineinander. Auf diese Weise entstand nicht nur ein äußerst stabiles, gewölbtes Dach, sondern auch ein neuer Fassadentyp. Denn an der Stirnseite geschieht etwas Spannendes: Die inneren Tonnengewölbe der drei Kirchenschiffe spiegeln sich außen als Rundgiebel wider. Der halb- und viertelkreisförmige Dachquerschnitt verleiht der Kirche ihre kleeblattförmige Silhouette.

Die Renaissance-Proportionen der Šibeniker Fassade
Das Gesicht der Kirche
Die Fassade (von lat. „facies“, das Angesicht) ist das Gesicht eines Bauwerkes. Manchmal, wie im Fall von Šibenik, lässt sie anschaulich auf das Innere schliessen. Manchmal dient sie aber auch wie eine Kulisse dazu, einem Bau mehr Grösse und Pracht zu verleihen. Dann ist die Rede von einer Blendfassade. Bestes Beispiel dafür sind die Giebel der venezianischen Gotik, die den klangvollen Namen „gotico fiorito“ (Blumengotik) trägt. Dort folgen die geschwungenen Ziergiebel nicht der dahinter liegenden geraden Dachform, sondern ragen weit darüber hinaus. So verwundert es, dass gerade diese kulissenhaften Blendgiebel Venedigs als Vorläufer des Šibeniker Kleeblattgiebels gelten. In Venedig hatte Juraj Dalmatinac zwar seine künstlerische Ausbildung und Karriere begonnen. Als er aber nach Šibenik berufen wird, lässt er nicht nur die Lagunenstadt hinter sich, sondern auch die dortige Tradition der gotischen Blendfassade. Das von ihm erfundene gewölbte Dach inspirierte ihn dazu, die verspielten gotischen Giebelverzierungen auf reine Kreisformen zu reduzieren. Mit ihrer funktionalen Einheit von Innen- und Aussenraum entspricht die Jakobskathedrale dem neuen Zeitgeist der Renaissance. Wiedergeburt und Rückbesinnung - auch auf übersichtliche geometrische Formen. Dieser Schritt zur vereinfachten Kleeblattform war die logische Konsequenz eines Architekten, der sich auf das Wesentliche beschränkte. Alles spricht dafür, dass die Kleeblattfassade in Šibenik unabhängig von Italien entstanden ist.

Kleeblattgiebel der Šibeniker Jakobskathedrale
Kleeblattgiebel in Europa
Bauwerke - ganz besonders ihre Fassaden - widerspiegeln Moden und Zeitgeist. Ist einmal ein Trend gesetzt, lässt er sich oft nicht mehr aufhalten. Bauherren und Architekten, die europaweit unterwegs waren, verbreiten neue Gestaltungsideen für Fassaden über Ländergrenzen hinweg. Besonders populär ist die Kleeblattfassade in Kroatien. Man kann sie überall an der östlichen Adria aufspüren: in Osor (Kathedrale), Zadar (Sv. Maria), Dubrovnik (Sv. Spas), Svetvin�ent (Sv. Marija), Pag (Sv. Juraj) und Hvar.
In Venedig findet man fast an jeder Strassenecke Kirchen und öffentliche Gebäude mit Kleeblatt- und Rundgiebeln (S. Maria dei Miracoli, Scuola di San Marco). Die früheste Kleeblattfassade erhielt San Michele in Isola von Mauro Codussi um 1470. Sie ist die älteste Renaissancekirche Venedigs. San Zaccaria, San Giovanni Crisostomo und die Chiesa dei Carmini folgten. Weitere Stationen außerhalb Venedigs waren Bologna (San Giovanni in Monte) und Sedrina (Pfarrkirche) in der Lombardei. So wundert es nicht, dass man - angesichts seiner großen Beliebtheit in Italien - vom „welschen“ Giebel spricht.
Auch nördlich der Alpen gehören Rundgiebel nun rasch zum gebräuchlichen Formenschatz der Renaissancearchitektur. Dabei bildet im deutschsprachigen Raum 1520 der Dom in Halle an der Saale den Auftakt. An der Ostseeküste entlang verbreitet sich der neue Fassadentyp weiter gen Norden bis Ostpreussen, Dänemark und Schweden. Selbst an Schlössern in Stockholm und Uppsala tauchen zur Mitte des 16. Jahrhunderts Kleeblattgiebel auf.
Weltkulturdenkmal
Im Jahr 2000 erklärte die UNESCO die Šibeniker Jakobskathedrale zum Weltkulturerbe. Das lässt hoffen, dass Dalmatien bei uns nicht nur wegen seiner sonnigen Adriaküste, sondern vor allem mehr noch wegen seiner reichen Kultur geschätzt wird.

Astrid Wappler,
M.A., Kunsthistorikerin in Leipzig
Aus der Libra Nr. 20, Zeitschrift des Kroatischen Kulturklubs
|